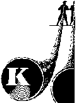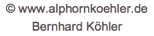Alphornblasen in Baden-Württemberg
Das Alphornblasen war in unserem Land nie ganz unbekannt. Schon die alten Germanen haben es gekannt und zwar auf nicht ganz angenehme Art und Weise. Die Römer benutzten alphornähnliche Instrumente beim Militär, die römischen Luren. Mit diesen Instrumenten wurde den römischen Legionen zum Kampf geblasen.
Ein Dichter wie Justinus Kerner zitiert es und Friedrich Silcher singt darüber.
Alphorn (Justinus Kerner)
Ein Alphorn hör' ich schallen
Das mich von hinnen ruft,
Tönt es aus wald'gen Hallen?
Tönt es aus blauer Luft?
Tönt es von Bergeshöhe,
Aus blumenreichem Tal?
Wo ich nun steh' und gehe,
Hör' ich's in süßer Qual.
Bei Spiel und frohem Reigen,
Einsam mit mir allein,
Tönt's ohne zu schweigen,
Tönt tief ins Herz hinein.
Noch nie hab' ich gefunden
Den Ort, woher es schallt,
Und nimmer wird gesunden
Dies Herz, bis es verhallt.
Wir wollen hoffen, daß das blumige, romantische Gedicht dem Dichter nicht wegen schlechter Intonation, falscher Töne oder der endlosen Länge des Vortrags eines geheimnisvollen Spielers Qualen und Herzbeschwerden bereitet hat. Auf jeden Fall ist das ein Zitat aus dem vorigen Jahrhundert über das Alphornspiel in Süddeutschland. Heute kann man das Alphorn so oft wie noch nie in unserem Lande hören. Süddeutsche hochkarätige zeitgenössische Komponisten haben sich des Instrumentes sogar angenommen und Werke dafür geschrieben.
Der in Reutlingen lebende Komponist Veit Erdmann-Abele hat für ein Konzert im Rahmen der Württ. Alphornbläsertreffen ein sehr effektvolles Werk in der gleichen Besetzung für Alphorn, Kammerorchester und Percussion komponiert. Der in Tuttlingen lebende Komponist Siegfried Burger hat neben Musik für mehrere Alphörner, den Psalm 23 in der Besetzung mit vierstimmigem gemischtem Chor, vier Alphörnern und Pauken vertont. Die Reihe ließe sich in bunter Folge und originellen Besetzungen von Kirchenorgeln bis zu Blechbläserbegleitung und Musikkapelle fortsetzen.
Das Alphorn - ein Volksinstrument
Das Alphorn ist ein sogenanntes Volksinstrument. Aufgrund seiner einfachen Naturtönigkeit wird es im sinfonischen Bereich nur bedingt eingesetzt (1. Sinfonie, Nr. 68, die sogenannte "Alpensinfonie" von Johannes Brahms). Man hat nur die Naturtöne. Damit lassen sich aber unzählige Motive und Alphornmelodien spielen. Das Spiel von Liedern ist verpönt, da sich nur im Naturraum vorhandene Töne verwenden lassen und Melodien dann verfälscht gespielt werden müssen. Besonders schön ist das Zusammenspiel mehrerer Alphörner. Auch dafür ist genügend Noten-Literatur geschaffen worden.
Im Jahre 1814 bemerkte der Kunstmaler F.N.König aus Unterseen: "Von dem Alphorn hört und sieht man fast nichts mehr. Ein Hauptzweck des angeordneten Volksfeste bey Unspunnen war eben der, diese eigentliche Alpmusik wieder zu erwecken, allein es blieb ohne einigen Erfolg..." Auch J.R.Wyss schien anlässlich seiner Reise ins Berner Oberland das Alphorn zu vermissen: "Wie sehr hätte ich gewünscht, daß in der Einsamkeit dieser Fels-umstarrten Öde das Alphorn uns entgegen getönt hätte. Aber die trockene Verständigkeit der neueren Zeit hat auch dieses von der älteren Sitte ausgetilgt." Das Alphornspiel war verschwunden, warum auch immer. Verschiedene Persönlichkeiten ließen auf ihre Kosten Alphörner bauen und sie an Bauern auf den Almen verteilen. Schließlich organisierte sich das Alphornblasen als volksmusikalisches Brauchtum, dem große Bedeutung zugemessen wurde. Der eidgenössische Jodlerverband nahm die Alphornbläser bei sich auf, was einen starken Boom bedeutete. Strenge Regeln sorgten dafür, daß die damals übliche Bettelbläserei alphornblasender Bauern abgestellt wurde.